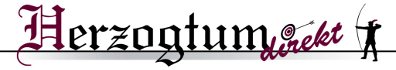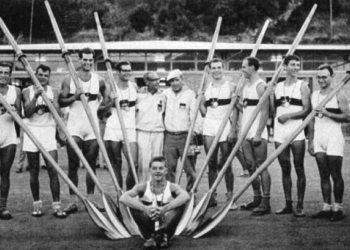Ratzeburg (pm). In diesem Jahr feiert Ratzeburg den 950. Jahrestag seiner ersten urkundlichen Erwähnung. Zu diesem Anlass planten drei Männer vor etwa einem Jahr die Sammlung und Veröffentlichung von Geschichten: Klaus-Jürgen Mohr, Vorsitzender des Senioren-Beirats, Christian Lopau, Archivar der Stadt, und Hans-Joachim Höhne, langjähriger Schulmeister. Im vergangenen Sommer suchte die kleine Redaktionsgruppe über die Presse nach passenden Beiträgen. Die Geschichten sollen die heutige und kommende Generationen an Menschen erinnern, die man mit dem Namen „Ratzeburg“ verbindet und deren Gedächtnis es wert ist, bewahrt zu werden. Mit freundlicher Genehmigung der Initiatoren werden diese jetzt auch auf Herzogtum direkt zu lesen sein. Im fünften Teil lesen Sie etwas über Originale an der Lauenburgischen Gelehrtenschule.
Emil Ackert, „Panje“ Wilhelm Brauer, Walter Helms: Erinnerungen von Ulrich Langfeld, selbst lange Jahre an der Lauenburgischen Gelehrtenschule
Emil Ackert
Das ausgeprägteste Original unter ihnen war „Emil“. Es war sein Vorname, den Schülern war kein originellerer Spitzname eingefallen, wie zum Beispiel etwa „Mox“ für Oberstudienrat Dr. Max Krätzer (mox lat. für bald – nicht sehr geistvoll, aber immerhin), „Eicha“ für Studienrat Müller (anstelle von Eijaja, das unter Zupfen am Spitzbart immer wieder in seine Rede eingeflochten war), oder „Panje“ für Studienrat Brauer. Der Name stimmte überhaupt, wenn auch seine Herkunft kaum auszumachen ist.
Emil Ackert war Lehrer für Zeichnen und Kunsterziehung für alle neun Klassen von Sexta bis Oberprima. Er trug den Titel „Oberschullehrer“ und war von 1907 bis 1945 an der Lauenburgischen Gelehrtenschule tätig, einer bemerkenswerten Zeit von 38 Jahren unter drei Staatsformen: Kaiserreich, Weimarer Republik und NS-Regime. Zu dem letzten zeigte er seine Einstellung in seiner von freiem Geist und Originalität zeugenden Art: Den obligatorischen Hitlergruß vor dem Unterricht umging er eher witzig. Er hob seinen rechten Arm auf halbe Höhe und schlug mit den Worten „Heil, Kinnigs, setzt euch“ seine Hand lässig nach unten.
Schon sein Äußeres entsprach seiner Originalität, er war klein und rundlich, hatte eine Stirnglatze und schütteres Haar, trug sommers und winters immer die gleich Art des Anzuges aus festem dunkelfarbigen Stoff, dazu eine entsprechende Weste. Besonders auffallend war sein freundliches, öfter schelmisches Gesicht, geprägt durch einen kräftigen, buschigen Schnurrbart mit einer Zigarre darunter und geränderten Brille mit runden Gläsern darüber. So stand er bei gutem Wetter auf der Freitreppe vor dem Portal, das die Umschrift in goldenen Lettern „Doctrinae – Sapientiae – Pietati“ trug, um die Schüler in Empfang zu nehmen. „Morgen, Herr Ackert“ – „Morgen, Herr Ackert“ – In der teilweise berechtigten Meinung, der persönliche Handschlag trüge propotional zur Hebung seiner Laune bei, gaben sie ihm die Hand. Gelegentlich wurde der Schüler auch mit einem brummigen „Nieche, nun lauf schon, Dicker“ abgewiesen. Dann sah Emil eher grimmig als schelmisch aus. (Das „Nieche“ konnte als „nicht wahr“ oder „sicher“ verstanden werden.)
Und darin zeigte sich auch die hervorstechende Seite seiner Originalität. Er war launisch, und man wußte nie, woran man war. Zeigte man ihm im Zeichenunterricht ein Bild, in der Meinung, man könne es abgeben – zumal Emil selbst es zwischendurch mit großen Pinselstrichen hilfreich korrigiert hatte – sagte er: „Wat is denn dat für ne Schmiererei!“ – Übrigens im rheinischen Tonfall, der eine auffallende akustische Ähnlichkeit mit Bömmel aus der „Feuerzangenbowle“ unterstrich. Wenn man aber eine Viertelstunde verstreichen ließ und das Bild dann vorzeigte, kriegte man ein wohlwollendes „Ja, kannst abgeben“ zu hören.
Uns Schüler, die wir von der Sexta an da waren, mochte er. Aber gegenüber den später hinzukommenen Schülern war er skeptisch, jedenfalls zunächst: „Nieche, du kommst sicher aus Hamburg!“
„Nein, aus Berlin!“
„Da siehst auch grad nach aus! Dann sieh man zu, wie du zurecht kommst!“
Seine Meinung, die er auch den Neuen gegenüber äußerte, war nämlich, sie kämen auf ihrem Heimatgymnasium nicht zurecht und die Eltern wollten es nun auf dem kleinen Provinzgymnasium versuchen.
„Warum kommst denn hierher?“
„Ja, mein Vater hat hier schon Abitur gemacht, und mein Großvater war hier Lehrer.“
„Ach, der alte Professor Jörß, den kenn ich ja noch.“ (Dr. Paul Jörß, der noch den Titel Professor trug, war Lehrer an der LG ab 1889, also zeitweise Kollege von Emil.) „Ja, wenn du Schwierigkeiten hast, helf ich dir!“
Aber sicher war man nie: Als Tertianer saß ich nach früherem Schulschluß vor den Pfingstferien, während fast alle Schüler und Lehrer das Schulhaus schon verlassen hatten, selber aber ohnehin auf den Zug warten mußte, noch im Klassenraum am Lehrerpult, um meine Aufgabe als Klassenbuchführer zu erfüllen: Es war die Eintragung ins Buch „Beginn der Pfingstferien.“ Währenddessen pfiff ich leise, aber ob der Ferien vergnügt vor mich hin. Plötzlich höre ich von der Tür Emils Stimme:
„Ach, du bist‘s, der hier immer pfeift! Wolln mal keine Schusterjungenmanieren einführen!“ Und auf dem Mittelgang auf mich zuschreitend, fügt er hinzu: „Ich werd dich einschreiben!“
Da er inzwischen bei mir angekommen war, hielt ich höflich den Füller hin, damit er gleich zur Tat schreiten könne. Übrigens war ich gewohnt, nach dem Unterricht im Zeichensaal ihm das Buch zur Eintragung des Stoffes vorzulegen. Dann schrieb er, wenn kein Füller zuhanden war, mit einem Streichholz, das er vorher in ein Näpfchen aus dem Tuschkasen eingetaucht hatte, mit sehr schöner künstlerischer deutscher Schrift. Jetzt aber nahm er das Buch, klemmte es unter den Arm und schritt den Gang entlang in Richtung Lehrerzimmer, offenbar um dort den Eintrag ordentlich vorzunehmen. Ich war mir nicht sicher, ob auf dem längeren Gang sein Zorn nicht verrauchen würde. Denn wenn er beispielsweise während des Unterrichts als Strafmaßnahme (zum Beispiel wegen Nicht-Gelernt-Habens) das schriftliche Ausarbeiten des Stoffes verhängte und der so gestrafte Schüler nach der Stunde zu ihm ans Pult trat und ihn scheinheilig fragte, was genau er denn tun solle, kriegte er möglicherweise auch die strafaufhebende Antwort: „Nu lauf schon!“
Mit solch einer Rücknahme rechnete ich im Stillen; umso gespannter griff ich nach den kurzen Pfingstferien nach dem Klassenbuch im Ständer auf dem Flur und las in Emils schöner Schrift: Langfeld wegen Pfeifens zu tadeln. A
Emil zeigte aber auch andere Schichten seiner Originalität:
Während in der Unter- und Mittelstufe Malen, Zeichnen und Schriftkunde den Unterricht ausmachten, kam später auch mal Kunstgeschichte vor, wenn auch sehr in Auswahl: „Niche, Kinnings, habt ihr schon mal Bilder von Pompeji gesehen?!
„Nein, Herr Ackert!“
„Dann zeig ich sie euch nächstesmal.“
Das geschah denn auch und wiederholte sich gewissermaßen als Zeremoniell im Laufe der Jahre, und zwar mit Hilfe eines alten Epidiaskops von erheblichen Ausmaßen. Darunter wurde das Buch mit Fotos gelegt, dessen Blätter nach und nach braune Brandspuren trugen trotz des Sausens der Kühlanlage. Dies Geräusch und Emils Vortrag säuselten vermutlich einige Schüler ein. Nicht nur wegen derer Interessenlosigkeit (oder auch der Bequemlichkeit des Lehrers) wurden spätere Wiederholungen wünschenswert: „Nieche, Kinnings, habt ihr schon ´mal Bilder von Pompeji gesehen?“ „Nein, Herr Ackert.“ —–
Aber die Sehnsucht blieb und das Verlangen danach, bis es nach fünfzig Jahren geschehen konnte, Pompeji selbst zu sehen.
„Panje“ – Wilhelm Brauer
Und Panje: Studienrat Wilhelm Brauer, seit 1919 an der Schule mit den Alten Sprachen und Geschichte. Von Panje kann man kaum erzählen, man müßte ihn sprechen hören, zumindest versuchen, in seiner Sprechweise von ihm erzählen, soweit überhaupt nachahmbar, mir als Mecklenburger annähernd möglich, weil er Mecklenburger war, und zwar aus Schwerin.
Aber sein Äußeres läßt sich etwa so beschreiben: Er war recht groß, Kopf und Gesicht waren markant mit kräftiger Nase und etwas vorgeschobener Unterlippe, er trug eine Kurzsichtigenbrille mit runden Gläsern und schmalen Metallbügeln; sein kurz geschorenes, gescheiteltes Haar lag, offenbar mit Nachhilfe von Wasser, glatt am Kopf, aber – und hier nun zeigt sich schon ein auffälliger Zug seiner Originalität bald nach Beginn des Unterrichts.
Wenn er den Stoff der letzten Stunde wieder aufnahm, kraulte er nachdenklich sein Haar, das sich dann in verschiedenen Richtungen selbständig machte. Dazu verstärkte an manchen Tagen jedenfalls noch ein zusammmen mit einem Teil des Kragens umgeklapptes Revers den Eindruck des Unordentlichen in der äußeren Erscheinung ein wenig. Ich weiß nicht, ob dieser Eindruck in Verbindung mit der nicht scharf geschliffenen, eher lässigen, aber gemütlichen ländlichen Sprechweise war, der ihm den Spitznamen Panje eingebracht hat.
Die Frage nach der Herkunft wird öfter gestellt. Bezeichnend für Panje ist aber, dass er in Selbstironie – auch das ist Kennzeichen des Originals – mit seinem Namen spielte: Während der Caesar-Lektüre ging es auch um die Germanen. „Ja, ja,“ sagte Panje schmunzelnd, „die Germanen hatten so ähnliche kleine Pferde, wie die Panje-Pferde in Polen und Rußland. – ja, ja, ich weiß schon, warum ihr g(e)rinnst!“ Dabei hatten wir höchstens andeutungsweise gegrinnst, wohl aus eigener Erfahrung oder der früherer Klassen, wissend, daß an bestimmten Stellen der lateinischen Lektüre diese Bemerkung kommen mußte.
Solche Wiederholungen gehören ja zum Original: Am Beginn einer Klassenarbeit, eines Extemporales, pflegte er sich nicht in die Mitte vor der Klasse, sondern in die hintere rechte Ecke zu stellen mit der Bemerkung:
„In der Ausbildung hat man uns gesagt, daß man bei einem Extemporale die beste Übersicht aus der Diagonale hat.“ Und die hielt er auch eine Weile inne; doch dann vergaß er die Diagonale und schritt gleichmässig vor der Klasse hin und her, den Kopf etwas erhoben mit quasi beseligtem Lächeln in die Ferne schauend, dabei die auf dem Rücken verschränkten Hände leicht auf und ab schlänkernd. Den abschreibenden Schülern konnte es nur recht sein, zumal er entgegen seiner ebenso wiederholten Behauptung „Ich sehe ja nicht so gut; aber meine Ohren sind vorzüglich.“ den ständigen Geräuschpegel nicht oder kaum wahrnehmen konnte.
Wer aber etwas lernen wollte, anstatt sich auf Panjes Unzulänglichkeiten und sich daraus ergebenden Möglichkeiten des Abschreibens aus einem „Schulmann“ zu verlassen, der konnte es bei Panje sehr wohl: Ich selbst habe unter anderem im Lateinunterricht sehr viel für meinen Ausdruck in der deutschen Sprache in syntaktisch-stilistischer Hinsicht gelernt. Panje legte viel Wert auf eine zwar genaue, aber dem Deutschen gemäße, ja elegante Übersetzung. Dazu gehörte etwa der Umgang mit Partizipalkonstruktionen.
Und: Geschichte wurde lebendig durch anschauliche, ja witzig-humorvolle Darstellung.
Witzig-humorvoll machte er gelegentlich auch kleine Exkursionen ins Persönliche: seine Töchter Helene und Ursula („die kleine Bärin“, wie er immer hinzufügte) spielten als Hinweis auf seine klassischen Fächer dabei eine Rolle; und dass er mit Leib und Seele Altphilologe war, zeigte sich, als er einmal zum Unterricht in unsere Klasse kam (1943) und jammerte: „Eben habe ich die letzte Prüfung im Griechischen gehalten. Man müßte Halbmast flaggen!“ (Griechisch war ja nach der Umwandlung der Schule in Deutsche Oberschule Auslaufmodell.)
Witzig war er auch im Umgang mit uns Schülern: Nachdem er zwei Jahre lang unser Klassenlehrer war und ich derzeit Klassenbuchführer, sagte er zum Beginn des neuen Schuljahres: „Langfeld, und Sie sind wieder mein Generalsekretär; und wenn Sie das noch zwei Jahre machen, dann sind Sie pensionsberechtigt.“ Ich war dann in der Tat noch zwei Jahre Klassenbuchführer, aber leider nicht als Panjes „Generalsekretär“; denn der irrsinnige Krieg rief uns Jungen an die Flugzeugabwehrkanonen.
Walter Helms
Als drittes Original soll nun noch vor Augen geführt werden Walter Helms:
Er war Studienrat seit 1927 mit den Fächern Altphilologie und Geschichte, nach dem Kriege als Oberstudienrat vorübergehend provisorischer Leiter der Schule. Merkwürdigerweise hatte er vor dem Kriege keinen Spitznamen. Wir nannten ihn Helms, allenfalls Papa Helms. Aber Schüler nach dem 2. Kriege nannten ihn Mucius nach dem römischen Volkshelden Mucius Scaevola. Der opferte der Sage nach im Jahre 508 v. Chr. seine rechte Hand beim fehlgeschlagenen Versuch, den Etruskerkönig Porsenna zu ermorden. Scaevola heißt schlicht und einfach Linkshand: Walter Helms hatte nämlich in den Kämpfen des 1. Weltkrieges die rechte Hand verloren; einen „patriotischen“ Bezug gab es für die Namensgebung wohl nicht und schon gar nicht irgendwelche Hinweise darauf durch den Lehrer. Aber dennoch gehörte die Tatsache zu seiner Gesamtpersönlichkeit:
Leidenschaftlichkeit für den Beruf, Fleiß und Temperament. Forderungen, die er an sich selbst stellte, galten auch den Schülern. Sie sollten etwas lernen, unter anderem Latein. Und wer lateinische Texte irgendwann mit Gewinn lesen und verstehen wollte oder sollte, mußte zunächst gut fundiert sein: Vokabeln, Deklinationen und Konjugationen lernen, ja pauken. „Konjugiere im Präsens: laudare!“ Das mußte schnell gehen. Und begleitet wurde jede Form durch einen Schlag mit der Holzhand auf die Innenseite der linken Hand oder auch auf den linken Unterarm, kräftig zumeist; und dabei löste sich auch schon mal die Holzhand und wurde schnell zur Seite auf den Tisch gelegt mit der kurzen Bemerkung „Hand ab“.
Ein besonders schlagendes Beispiel für die Holzhand-auf rechten-Unterarm-Methode war die anstelle von der allgemein üblichen Betonung auf ‚an‘ in Alexandria die philologisch korrekte Betonung auf ‚i‘ in rhythmischer Reihung: „Alexandria! Alexandria! Alexandria!“ Wenn aber etwa die Konjugation nicht schnell oder präzise genug ging, gab es kurz mit der linken Hand auf die rechte Backe des Schülers eine Ohrfeige: „Ei, ei, die Faulen kann ich gerade leiden!“
Mir ist auf höherer Klassenstufe Entsprechendes passiert: Geschichte des Mittelalters, nur dass statt der grammatischen Formen Fakten und Namen Grundlage und Fundament für Zusammenhänge bilden sollten. In einem mir später von Helms überlassenen Geschichtslehrbuch sind eine Fülle von handschriftlichen Anmerkungen und Zusätzen zu finden, die darauf hinweisen, und – ein Zettel, auf dem zur Sinndeutung der Geschichte handscchriftlich zitiert wird (Autor unlesbar):
„Wir müssen es mit der Geschichte halten wie mit dem Reisen. Es weitet, bereichert u. reift; und so weitet, bereichert u. reift das Wandern in die Zeit zurück und das Besinnen auf Möglichkeiten voraus. Das ist viel, und mehr dürfen wir nicht verlangen.“
Also, das ist passiert:
Helms betritt mit gewohntem Schwung das Klassenzimmer: „Setzen! Die salischen Kaiser!“ eilt den Mittelgang entlang, die einzelnen Schüler durch kurzes Zeichen zur Antwort auffordernd. Bei diesem Tempo war es gar nicht möglich, zumal natürlich bei Unkenntnis, die salischen Kaiser auf Anhieb herunterzurasseln. Ich selbst saß in der zweitletzten Reihe und hatte genügend Zeit, mich zu besinnen und richtig zu antworten. Aber in der Hitze des Gefechts wurde ich von der Ohrfeige nicht verschont. Ohne die Souveränität des Originals könnte das peinlich sein. Aber die blitzschnelle Reaktion war: „Hast noch eine zugut!“
Heute (2012) allerdings nicht mehr. Denn das ereignete sich zehn Jahre später: Ich konnte, da ich einen Paß zum Kirchentag in Hamburg 1953 erhalten hatte, nach Krieg und Teilung Deutschlands endlich wieder Ratzeburg und die alte Schule besuchen. Ich wurde von meiner ehemaligen Mathematik- und Chemielehrerin Fräulein Wiese zum Kaffee eingeladen (sie war kein Original, aber eine Persönlichkeit), ebenso Helms. Wir sprachen natürlich von der Schule — und den Originalen. Ich erzählte von den „salischen Kaisern“, und – typisch seine Reaktion – : Helms wollte sich totlachen.
„Dann nennen Sie sie mal!“
„Das kann ich nicht mehr.“
„Dann sind wir ja quitt!“
Es erlebte also der ehemalige Schüler das Original Helms anders als der Sextaner oder später der Schüler der oberen Klassen in veränderten Zeiten. Aber mitgenommen habe ich damals – bis heute ja unverloren – aus der begrenzten Behaglichkeit der Schule einen Blick in die historische, geographische, sprachliche und künstlerische Weite der Welt, beides vermittelt unter anderem durch die drei verehrten Originale der Lauenburgischen Gelehrtenschule.
Lothar Roeßler und Alfred Tredup
Lehrer war er, vor allem Biologie-Lehrer, an der Lauenburgischen Gelehrtenschule. Schon sein Vater hatte als Musik-Lehrer an der alt-ehrwürdigen Anstalt gearbeitet. Und er war Naturschutz-Beauftragter für den Kreis Herzogtum Lauenburg: Lothar Roeßler (1907 – 1990). Die Natur lag ihm so sehr am Herzen, dass er keiner Fliege etwas zuleide tun konnte – im wahrsten Wortsinn. Wer einmal bei ihm Unterricht hatte, mag sich an solche Szene erinnern: Mitten in der Stunde (vielleicht Erdkunde), bemerkte er an einer Fensterscheibe ein Tierchen, eine Fliege. „Seht doch, Kinder, was wir hier haben!“ Und aus der Erdkunde- wurde, jedenfalls für eine geraume Weile, eine Biologie-Stunde mit eindeutigem Unterrichts-Ziel: Ehrfurcht vor dem Leben wecken bzw. erhalten. In eindringlichen Worten machte ihr Lehrer den Kindern deutlich, warum auch ein so kleines Wesen ein Recht auf Leben hat, aber auch, wie schön ein scheinbar unansehnliches Tier in Wirklichkeit ist. Manchem von den Mädchen und Jungen mag das erst viel später ins Bewusstsein gelangt sein, hat dann aber doch bei vielen wohl seine Wirkung hinterlassen.
Es gibt eine herrliche kleine Geschichte, die so geschehen sein kann (aber nicht muss). Lothar Roeßler ging mit seiner Frau am Küchensee spazieren. Die Familie wohnte ja in ihrem Haus am Ende des Farchauer Weges, und das war sicher der Platz, an dem, und nur an dem der leidenschaftliche Naturfreund leben konnte. Es war wohl ein Sonntag, man erzählt jedenfalls von dem „Guten Anzug“, den L.R. trug. Plötzlich stutzte er. Was sich dort unten, nahe am Ufer, im Sumpf bewegte, konnte nur eine Schlange sein! Sie war zu weit weg, als dass er erkennen konnte, ob es eine Kreuzotter oder eine Ringelnatter und wie groß sie war. Lothar ließ seine verdutzte Frau stehen und stapfte, stolperte, watete durch den Sumpf. Wer am See aufgewachsen ist, wird sich vielleicht aus der Kinderzeit an solche Erlebnisse erinnern. Aus der Kinderzeit! Es ist nicht überliefert, ob es dem Biologen gelang, seinen Wissensdurst zu stillen. Wir können auch nichts über Frau Roeßlers Reaktionen sagen. Das traurige Schicksal des „Guten Anzugs“ vermögen wir uns aber auszumalen.
Bauplatz, Wohnort am Ende des Weges Richtung Farchau: Da gab es gewiss Schwierigkeiten, notwendiges Material heran zu schaffen. Ein möglicher Weg führte über das Wasser. Roeßler hatte sich ein altes Pionierboot von stattlicher Länge besorgt. Eines Tages fragte er nach dem Unterricht einige Obersekundaner (11-Klässler), ob sie nicht Zeit und Lust hätten, ihm beim Be- und Entladen und beim Transport von Kies zu helfen, den man ihm zum Ufer (links vom heutigen „Seehof“) geliefert hatte. Das war die richtige Arbeit für Jungen von 17 Jahren! Man traf sich nachmittags, schaufelte den Kies in den Kahn, nahm die Stechpaddel zur Hand und stach (auf dem Kieshaufen sitzend) fröhlich in See. Nicht mehr lange fröhlich! Hatte der Herr Studienrat den Kahn mit Werg kalfatert oder nicht? Jedenfalls sog sich der Kies mit Wasser voll, das von unten eindrang: Der Kahn hatte ein Leck – oder mehrere. Das ist nun mal bei einem Holzboot so: Es muss lange genug im Wasser liegen, damit die Planken quellen und die Ritzen schließen, die beim Trocknen entstehen. Der Kies wurde schwerer und schwerer, der Kahn sackte tiefer und tiefer, endlich gab es noch eine Handbreit zwischen Wasser und Bordwand. Na klar: Ratzeburger Jungs können schwimmen, kennen auch in solcher Situation keine Angst. Aber sie schauen den „Käptn“ an und machen ihn auf die Lage aufmerksam, denn er scheint die noch nicht bemerkt zu haben. Und der? Mit stoischer Ruhe weist er seine Mitarbeiter darauf hin, dass es sich um ein absolut sicheres Schiff handle und dass sie keineswegs beunruhigt sein müssen. Und allein seine sonore Stimme zeigt: Er bleibt die Ruhe selbst. Es gibt keine Katastrophe, der Kies wird glücklich angelandet, und vier jugendliche Ratzeburger sind um eine Erinnerung reicher.
Außer der Natur hatte Lothar Roeßler eine andere große Liebe: die Musik. Auf einem alten Foto (um 1930) vom Spielmannszug des „Deutschen Jugendkorps“ ist er mit etwa 40 jungen Männern zu sehen. Vor allem aber liebte er das Orgelspiel. Als die Familie ihr Haus im Farchauer Weg bezog, leistete Roeßler sich eine eigene „Hausorgel“. Die wurde ihm nach einiger Zeit mit ihren nur vier Registern jedoch zu klein, und also ließ er sich von seinem Orgelbauer eine zweite, größere bauen. „Größere“, das heißt, der Spieler konnte nicht nur mehr Register ziehen; das Instrument hatte natürlich auch größere Pfeifen. Die größten kamen mit der lichten Höhe im Erdgeschoss nicht aus. Was blieb übrig? Die Decke zum ersten Stock musste geöffnet werden, soweit erforderlich, die größten Orgelpfeifen reichten nun über zwei Etagen – bis in das Schlafzimmer, bis in den Kleiderschrank! Ratzeburg war um eine geniale Problemlösung reicher.
Soweit ein paar Erinnerungen an Lehrer der LG. Wir können jedoch die Lauenburgische Gelehrtenschule nicht verlassen, ohne an ihren langjährigen Direktor Adolf Tredup (1899 -1988) zu denken.
Viel gäbe es zu berichten; bestimmend für das Bild dieses Mannes sind aber für so manchen alten LG-Schüler – die Immen, die Honigbienen! Friedrich-Karl Zechlin war einige Jahre Biologie-Lehrer, ist bis heute passionierter Imker und erinnert sich an seine erste Begegnung mit dem Pensionär Adolf Tredup:
Der Vorsitzende des Ratzeburger Imkervereins, Eberhard Wolkenhaar aus Bäk, lud Zechlin, den Biologie-Lehrer seiner Enkel, zu einer Imker-Versammlung ein. Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ stand ein alter Imker auf: „Ik heff Immen to verköpen, Volk und Beute föfftig Mark. Dor sünd veertig Völker ut’n Nachlass in Klinkrade an den ollen Bahnövergang na Kastörp.“ Sollte Zechlin kaufen? Gut und schön: Er kaufte, beraten durch den bundesweit anerkannten Fachmann und damals schon uralten Realschul-Lehrer Johannes Falkenberg, zehn Völker.
In der Folgezeit trafen sich Tredup und Zechlin des öfteren in den Versammlungen wieder. Tredups Kommentar in seiner markanten, Zigarren-verrauchten Stimme: „Is ja nett, dass da oben (gemeint war die neue LG oben im Fuchswald) mal wieder einer in Bienen macht.“ In den fünfziger Jahren tat Zechlins Vetter Friedrich Lüth als junger Vikar Dienst im Alumnat, dem Schülerheim der LG neben der Schule, und als Religionslehrer. Er „fand es sehr bemerkenswert, dass im Unterricht Bestelllisten für Honig des Schulleiters durchliefen.“
Und eine letzte kleine Geschichte vom Imker Tredup mag erwähnt werden. Sie ist vielen ehemaligen Schülern bekannt, ist vielleicht wirklich so geschehen oder kann doch so geschehen sein: Ein Oberschulrat vom Ministerium ist aus Kiel gekommen und nimmt an der Unterrichtsstunde eines jungen Kollegen teil, mit ihm natürlich der Schulleiter und Ober-Studien-Direktor Adolf Tredup. Mitten in der Stunde hört man ein leises Klopfen an der Klassentür. Der Hausmeister eilt zu seinem Chef, flüstert ihm etwas ins Ohr. Tredup steht eilend auf: „Entschuldigung, Herr Oberschulrat, ich muss unbedingt nach Haus: Die Immen schwärmen.“ – und verschwindet. – Das könnte so auch bei Wilhelm Busch stehen!
Bisher erschienen:
Teil 4 „Erinnerungen an den Ratskeller“
Mehr auf www.ratzeburg.de.