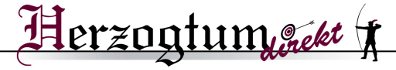Den Ruhestand wird Hans-Werner Könecke in diesem Leben wohl nicht mehr erreichen. Zu groß ist augenscheinlich die Leidenschaft des 80 Jahre alten Bildhauers für die Kunst. Immer noch arbeitet er Woche um Woche in seinem Reinbeker Atelier. Das Leben – für Könecke ist es und bleibt es vor allem die Suche nach einer perfekten Form. Immerhin: Für Kulturportal-Herzogtum.de erlaubt er sich eine kurze Auszeit. Im Interview spricht er über seine Kindheit und den langen Weg zu einem erfolgreichen und international anerkannten Bildhauer.
Kulturportal-Herzogtum.de: Ab wann waren Ihnen klar, dass die Kunst Ihre Sache ist?
Hans-Werner Könecke: Ich habe als Junge schon immer gerne etwas gebastelt und bin dann nach der Schulzeit in die Lehre gegangen. Gelernt habe ich bei den Bergedorfer Eisenwerken „Alvalawal“. Das ist eine deutsch-schwedische Firma, die seinerzeit die größten Webstühle der Welt und Molkereimaschinen hergestellt hat. In dieser Firma habe ich Modelltischler gelernt. Die Lehre setzte sich aus zwei Fachbereichen zusammen – Modellbau, also Arbeit mit Metall, und Modelltischler, Arbeit mit Holz. Während der Lehrzeit habe ich immer mal etwas gestaltet – zum Beispiel eine kleine Figur aus Holz oder aus Ton. Ich habe also schon ganz früh angefangen, künstlerisch zu arbeiten. Ich habe auch viel gemalt und gezeichnet in der Zeit bei meinen Großeltern.
KP: Sie waren als Kind bei Ihren Großeltern?
Könecke: Meine Eltern sind beide im Krieg umgekommen. Meine Schwestern und ich waren plötzlich Waisenkinder. Wir sind damals zunächst zu meinen Großeltern nach Mölln gekommen. In der Phase habe ich angefangen zu zeichnen und zu malen. An der Wassertorbrücke stand eines Tages ein etwas älterer Mann hinter mir und guckte mir zu, während ich malte. Ich wollte im Bild die Weide mit der Spiegelung im Wasser und die Stadt dahinter festhalten. Der Mann fragte mich freundlich, ob er mir behilflich sein dürfe? Er nahm mir den Pinsel aus der Hand zeigte mir mit wenigen Pinselstrichen, worauf es ankommt.
KP: Wer war der Mann?
Könecke: Das war der Maler Max Ahrens. Wir standen uns beide sofort menschlich sehr nahe. Er hat mich damals erstmal vollkommen kostenfrei unterrichtet. Von ihm habe ich vor allem gelernt, die Dinge richtig anzugucken und Momentaufnahmen festzuhalten. Das war eine gute Schule.
KP: Wissen Sie noch, wann das war?
Könecke: Das muss Mitte der 50er Jahr gewesen sein. Das war noch vor der Lehre – während der Schulzeit. Ich war da 13, 14 Jahre alt.
KP: Sind Sie während der Lehrzeit in Mölln geblieben?
Könecke: Nein, ich habe bei der Schwester meiner Mutter in Hamburg gewohnt – im Horner Weg. Von Horn aus habe ich dann täglich den Weg zu Fuß zum Hasselbrook-Bahnhof gemacht und bin mit der S-Bahn zwei Stationen zum Berliner Tor. Von dort fuhr damals noch ein Dampfzug nach Bergedorf. Die Lehre war für mich eine segensreiche Angelegenheit. Von unserem Lehrlingsingenieur Dr. Blum haben wir wahnsinnig viel gelernt.
KP: Was geschah nach der Lehrzeit? Sind Sie dann an die Uni gegangen, um Kunst zu studieren?
Könecke: Nein, eigentlich bin ich Autodidakt. Ich habe aber in Schweden einen Freund gehabt, der Bildhauer war. Bei dem bin ich eine ganze Zeit gewesen. Die Verbindung kam über die Bergedorfer Eisenwerke zustande, die mich gefördert haben. Dieser Bildhauer hat mich dann aber irgendwann weggeschickt. Hau ab – hat er gesagt – du kannst bei mir nichts mehr lernen!
KP: Wenn jemand offen sagt, dass er Künstler werden möchte, reagieren Nahestehende nicht selten mit Skepsis oder sogar mit Ablehnung. Wie war das bei Ihnen?
Könecke: Bei mir war das eigentlich auch so. Ich habe allerdings nie diesen Satz benutzt: Ich will Künstler werden. Ich habe eigentlich immer nur aus meinem Inneren heraus das Bedürfnis gehabt, mir etwas genau anzugucken und eventuell daraus etwas zu entwickeln oder wiederzugeben. Das ist so ein Faden, der läuft mein ganzes Leben durch.
KP: Das Ganze hat sich also sozusagen organisch entwickelt.
Könecke: Ja.
KP: Haben Sie plötzlich Aufträge bekommen?
Könecke: Nein. Ich habe zwischendurch gearbeitet. Ich hatte ja zwei Kinder. Da kommt man in einen Zwang hinein. Der Lebensunterhalt muss ja irgendwo herkommen. Und dann habe ich erstmal das getan, was ich am besten konnte. Ich habe kleine Bilder gemalt, die jemand, den ich gut kannte, für mich verkauft hat. Außerdem habe ich Reliefs gemacht, 1,4 mal 0,6 Meter – Stadtansichten von Hamburg, die wir dann gegossen haben. Und zwar, weil das nicht so teuer ist, in Aluminium. In der Phase lernte ich auch den Journalisten Herbert Godyla kennen, der in der Bergedorfer Zeitung von einem kleinen Atelier im Untergeschoss eines Wohnhauses schrieb, das ich gemietet hatte. Danach riefen mich dann Leute an. Ich hatte ja inzwischen Telefon.
KP: Ich habe irgendwo gelesen, dass Sie eigentlich Maler werden wollten, aber mehr Talent als Bildhauer besaßen…
Könecke: Das ist eine Legende. Ich habe von mir aus, weil ich ja aus der Gießerei kam, die plastischen Dinge gesehen, die da abgeformt und letztlich in Eisen oder auch in besseren Legierungen gegossen wurden. Das habe ich hautnah miterlebt. Wir haben ja auch für das, was wir da produziert haben, die Modelle gemacht, so dass die Dreidimensionalität immer schon dabei war. Das führte dazu, dass ich ein Modell, das ich bauen sollte, von mir aus verändert habe. Der Konstrukteur hatte mir eine Zeichnung gegeben, die ich nicht so formschön fand. Der Meister, der sehr aufgeschlossen war, sagte: Mach das mal, wir lassen den Konstrukteur denn mal kommen – und der Konstrukteur sagte dann, ja, das ist viel besser als meins.
KP: Das war während Ihrer Lehrzeit 1957/1958 – von da an haben Sie dann quasi die ganze Zeit selbständig gearbeitet?
Könecke: Naja – das ging mehr in die 60er Jahre rein. Ich habe teilweise noch für einen Verlag gearbeitet, für den ich Buch-Einbände entworfen habe, aber so ein bisschen war ich mit dem einen Bein immer im Künstlerischen. Im Laufe der Jahre habe ich dann gelernt, wie man am besten produziert und wie man am besten gestaltet, um eben auch Käufer zu finden. Da war natürlich auch immer Druck. Da muss man sich manchmal in die Richtung biegen, dass man etwas macht, was man selber nicht so gestaltet hätte. Aber inzwischen bin ich ganz eigenständig. Ich arbeite fast nie im Auftrag, außer bei größeren spektakulären Sachen wie einem Wettbewerb.
KP: Das ist der Segen der guten Tat, wenn man es dann schafft, seine Arbeiten zu verkaufen.
Könecke: Andererseits ist da immer die Notwendigkeit, Geld zu verdienen.
KP: Wenn es denn gut geht, ist alles gut. Aber das Scheitern steht ja immer mit im Raum – wie groß waren Ihre Ängste, es nicht zu schaffen?
Könecke: Die waren nicht klein. Das kann man ruhig sagen. Deswegen habe ich zwischenzeitlich immer mal in einer Firma gearbeitet oder einen Job gehabt. Aber der rote Faden lief eigentlich seit der Lehrzeit immer durch und die letzten 40 Jahre habe ich nur noch von meinen Arbeiten als Bildhauer gelebt.
KP: Womit wir beim Thema wären. Ihre Werke wirken klar und eindeutig. Sie modellieren Tiere, Menschen, Historisches, Mythen. Haben Sie auch mal abstrakt gearbeitet?
Könecke: Ich hatte eine Phase, in der ich ganz spontan modellierte. Da habe ich einiges ausprobiert. Ich komme aber immer wieder auf die alten Griechen zurück. Mich fasziniert, was sie gemacht haben. Welch hohe Wirkung das heute immer noch hat. Bei einer Rom-Exkursion waren wir mal mit einer kleinen Gruppe angehender Künstler in der Villa Borghese. Dort habe ich den Dornauszieher gesehen – von einem unbekannten Griechen 200 Jahre vor Christus geschaffen. Die Figur habe ich gezeichnet und da habe ich gemerkt, wie viel Potential darin steckt. Man denkt ja erst: Da sitzt halt so ein Junge. Aber da ist jeder Muskel im Rücken und die ganze Bewegung zu sehen. Und dann trotzdem diese Schlichtheit – das ist ja keine griechische Figur, die sich in Pose stellt, sondern der Junge sitzt, weil er was im Fuß hat und versucht sich das rauszuholen. Daher auch „Dornauszieher“. An dieser Figur habe ich mich hochgehangelt. Die habe ich dann später anhand meiner Skizzen und aus meinem Gedächtnis heraus noch mal selbst modelliert.
KP: Das Eindeutige wirkt so selbstverständlich, so selbstgewiss, aber wie selbstgewiss ist man, wenn man sich an so eine Figur heranwagt?
Könecke: Da ist immer auch Kampf. Man hat ja alle Möglichkeiten den Ausdruck so, so oder so zu machen. Auch wenn das eine oder das andere sehr realistisch ist und der Natur sehr nahekommt. Ich glaube, das Schwierigste ist, den richtigen Moment festzustellen, wie soll die Figur letztendlich aussehen? Die entscheidende Phase ist, wenn ich anfange.
KP: Das heißt: Sie haben die Idee und legen los und dann merken Sie, dass das, was sie da gerade machen, so gar nicht Ihrer Vorstellung entspricht. Das muss einen doch manchmal wahnsinnig machen. Was machen Sie, wenn Sie nicht weiterkommen?
Könecke: In der Regel mache ich dann erstmal Pause – also erstmal gar nichts. Wenn ich Schwierigkeiten entdecke, versuche ich irgendwie um sie herumzugehen und irgendwo die Lücke zu finden, wo ich dann ansetzen kann. Das geht nicht mal eben so. Und dann gibt es wieder Figuren, da ist alles klar.
KP: Hat das damit zu tun, dass die Figuren so klar sind oder ist das eher Zufall?
Könecke: Es ist eine Mischung aus beidem. Das ist eben die Gestaltung, die ja immer noch möglich ist, wenn man eine Figur mit Ton aufmodelliert. Man kann dann ja mit der Hand reingreifen und das wieder wegwischen und noch mal von vorn beginnen. Das ist die Spontanität mit dem Material Ton. Früher habe ich auch mal aus einem Holzblock eine Figur rausgeschlagen – das mache ich jetzt nicht mehr. Heute modelliere ich und decke das dann über Nacht ab – Ton fängt ja an zu trocknen. Am nächsten Tag gucke ich mir das Modell dann nochmal an, um zu sehen, ob ich richtig gelegen habe. Dann mache ich mir eine Form. Dafür gieße ich über den Ton eine Gipsschale – wie ein Ei – und pelle das wieder auseinander. Die Schale gieße ich dann mit Gips aus. Das macht man natürlich so, dass man das auch wieder auseinanderkriegt. Ein Mensch, der da so sitzt mit den Armen, der muss ja in alle Richtungen auseinandernehmbar sein, damit man das nachher auch plastisch wieder zusammenfügen kann.
KP: Herr Könecke, zum Schluss möchte ich noch mal auf die Ausgestaltung Ihrer Tierfiguren zu sprechen kommen. Wenn man die vielen menschlichen Facetten in Ihrem Werk heranzieht, fällt auf: Die Tiere sind zu schön und zu klar, um wahr zu sein. Insbesondere wenn ich daran denke, wie unsere Gesellschaft mit Tieren umgeht. Was steckt dahinter?
Könecke: Ich möchte, dass damit die Zuneigung des Menschen zu den Kreaturen ein bisschen bekräftigt wird.
KP: Herr Könecke, ich danke Ihnen für diesen spannenden Einblick in Ihre Arbeit und Ihren künstlerischen Werdegang.