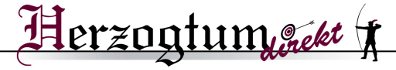Berlin (pm). Im Jahr 2024 gab es ungefähr 677.000 Geburten in Deutschland. Rund jede fünfte Mutter entwickelt nach der Geburt psychische Probleme, das sind etwa 135.000 Gebärende. Viele fühlen sich überfordert, hilflos oder haben Schwierigkeiten, eine Bindung zum Kind aufzubauen. Eine neue Studie der Technischen Universität Dresden zeigt nun: Eine gezielte teilstationäre Mutter-Kind-Therapie kann die psychische Gesundheit der Mutter deutlich verbessern. Die positiven Effekte halten auch ein Jahr nach Ende der Behandlung an und stehen im Zusammenhang mit weniger Verhaltensauffälligkeiten bei den Kindern. Doch es fehlt an flächendeckenden Therapieangeboten. Die Deutsche Gesellschaft für Psychosomatische Medizin und ärztliche Psychotherapie e.V. (DGPM) fordert entsprechende Versorgungsangebote.
Die Geburt eines Kindes ist für viele Frauen eines der intensivsten Erlebnisse ihres Lebens – geprägt von körperlicher Verausgabung, aber auch großer Vorfreude. Doch die anfängliche Freude hält nicht immer an: Zahlreiche Mütter kämpfen nach der Geburt mit Ängsten, Erschöpfung oder Depressionen. „Wenn sich Mütter belastet oder allein gelassen fühlen, spürt das auch das Kind“, erläutert Professorin Dr. med. Kerstin Weidner, Gründerin der Mutter-Kind-Tagesklinik und Direktorin der Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik des Universitätsklinikums an der TU Dresden.
348 Mütter, ein Jahr im Blick
In einer umfangreichen Studie hat sie gemeinsam mit Psychotherapeutin Dr. re. nat. habil. Susann Schmiedgen und ihrem Team 348 Mütter mit psychischen Erkrankungen – darunter Depressionen, Angst- und Persönlichkeitsstörungen – begleitet. Die Mütter wurden im ersten Jahr nach der Geburt aufgenommen. Im Fokus stand eine im Durchschnitt 32-tägige interaktionsfokussierte Therapie in der Tagesklinik, die nicht nur Einzel- und Gruppensitzungen umfasste, sondern vor allem die Beziehung zwischen Mutter und Kind stärkte. Durch Videoanalysen, spielerische Übungen und gemeinsame Alltagsinteraktionen lernten die Frauen die Bedürfnisse ihrer Kinder besser wahrzunehmen und zu verstehen, auf ihre Kinder einzugehen und sich als Eltern sicherer zu fühlen.
Deutlich weniger psychische Belastung – und stabilere Eltern-Kind-Beziehungen
Das Ergebnis beeindruckt: Bereits bei Entlassung waren depressive Symptome, Ängste und wahrgenommer Stress deutlich reduziert. Gleichzeitig wuchs das Vertrauen der Mütter in ihre elterlichen Fähigkeiten. „Diese positiven Effekte blieben bis zu einem Jahr nach der Therapie stabil“, berichtet Dr. Schmiedgen. Wichtig ist auch der Blick auf die Kinder: Je besser sich der psychische Zustand der Mutter langfristig entwickelte, desto geringer waren Verhaltensauffälligkeiten bei den Kleinen. „Das unterstreicht die enge Verbindung zwischen mütterlicher psychischer Gesundheit und dem Wohlbefinden der Kinder“, so Dr. Schmiedgen.
Früher erkennen, gezielter helfen: Neue Leitlinien für bessere Versorgung
Parallel zur Studie in Dresden arbeiten zwei bundesweit geförderte Projekte – PERIPSYCH und PERITRAUMA – unter der Leitung von Professorin Dr. med. Kerstin Weidner daran, wissenschaftlich fundierte Leitlinien für die Diagnostik und Behandlung psychischer Erkrankungen rund um die Geburt zu entwickeln. Ziel ist es, Ärztinnen und Ärzte sowie Fachkräfte in der Jugend- und Familienhilfe besser darin zu schulen, seelische Belastungen bei Müttern frühzeitig zu erkennen und betroffene Familien gezielt sowie abgestimmt zu unterstützen.
Hilfe, die ankommt – aber zu selten verfügbar ist
Trotz dieser vielversprechenden Ergebnisse und Arbeit in diesem Bereich fehlt es nach wie vor an flächendeckenden spezialisierten Angeboten für belastete Mütter. Tageskliniken wie die in Dresden sind deutschlandweit selten. „Wir appellieren deshalb an das Gesundheitssystem, mehr niederschwellige und gezielte Hilfsangebote zu schaffen und ein Screening zu etablieren, um in dieser sensiblen Lebensphase Leiden zu verhindern und Familien nachhaltig zu stärken“, betont Professor Dr. med. Hans-Christoph Friederich, Ärztlicher Direktor der Klinik für Allgemeine Innere Medizin und Psychosomatik, Universitätsklinikum Heidelberg und Vorsitzender der DGPM.