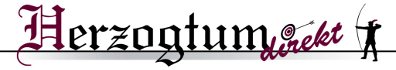Rendsburg (pm). Der Frühling liegt in der Luft. Die ersten Winterlinge, Krokusse und Osterglocken sprießen selbstbewusst aus dem Erdreich und kündigen das Ende der dunklen Jahreszeit an. Auf den Feldern laufen die Frühjahrsarbeiten auf Hochtouren. Im Februar und März wird vielerorts mit Gülle und Mist, Gärresten aus Biogasanlagen oder Mineraldünger gedüngt, um den erwachenden Pflanzen ideale Startbedingungen für ihr Wachstum zu bieten.
Doch warum werden die Felder überhaupt gedüngt?
Pflanzendüngung kann auch als Pflanzenernährung bezeichnet werden. Bei jedem Wachstumsprozess entzieht die heranwachsende Pflanze, zum Beispiel Getreide, Raps oder Erdbeeren, dem Boden Nährstoffe. Mit der Ernte der Früchte werden Nährstoffe abgefahren und stehen somit dem Boden nicht mehr zur Verfügung. Damit der Boden nicht immer nährstoffärmer wird, müssen die entzogenen Stoffe durch Düngung ergänzt werden. So kann der Landwirt nicht nur hohe Erträge sichern, sondern auch die Bodenfruchtbarkeit und Bodengesundheit erhalten. Je nach Betriebsrichtung stehen den Landwirten unterschiedliche Düngerformen zur Verfügung. Landwirtschaftliche Betriebe nutzen organische Dünger wie Gülle oder Mist und dazu mineralische Dünger oftmals in Kombination.
Und wie ermittelt der Landwirt seinen Düngebedarf?
Durch eine Bodenuntersuchung werden die pflanzenverfügbaren Nährstoffe im Boden ermittelt. Da der Nährstoffbedarf je nach angebauter Kultur variiert, kann die Düngeplanung durch den Landwirt jedes Jahr entsprechend angepasst werden. Gedüngt wird bedarfsgerecht. Das bedeutet, dass nur so viel gedüngt wird, wie die Pflanzen benötigen. Um diese sogenannte Düngebedarfsermittlung kümmert sich der Landwirt bereits im Januar eines jeden Jahres. Zu viel gedüngte Nährstoffe schaden der Umwelt, führen zur Eutrophierung der Gewässer und belasten das Klima. Deshalb ist die maximale Düngermenge in der gesetzlich verankerten Düngeverordnung vorgegeben und betriebswirtschaftlich untermauert. Denn ab einem bestimmten Punkt ist es unwirtschaftlich, die Düngermenge weiter zu steigern, da der damit erreichte Mehrertrag immer geringer ausfällt.
Seit seiner Gründung am 12. Februar 1947 ist der Bauernverband die Interessenvertretung von Landwirtschaft und ländlichem Raum in Schleswig – Holstein. Aufgabe des Verbandes ist es, landwirtschaftliche Anliegen auf allen Ebenen einzubringen und durchzusetzen. Nicht nur in der Agrarpolitik, sondern auch in der Wirtschafts-, Rechts-, Sozial- und Umweltpolitik vertritt der Verband die Interessen seiner Mitglieder.